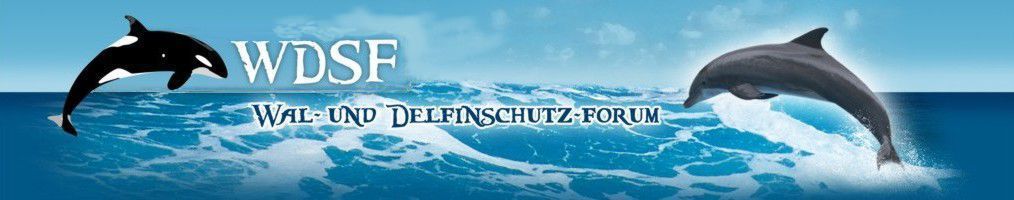Bestand

Liste der Delfinarien in Europa/Welweit
Auflistung der acht verstorbenen Delfine im Delfinarium des Allwetterzoo Münster (Ceta Base)
1) Nando (Großer Tümmler) - Nachzucht - geb. 06.06.1990 - seit 1996 in Münster (aus Nürnberg) - am 05.02.2013 nach Harderwijk
2) Rocco (Großer Tümmler) - Nachzucht geb. 01.07.2005 - seit 25.09.2008 in Münster (aus Harderwijk) - am 05.02.2013 nach Harderwijk
3) Palawas (Großer Tümmler) - Nachzucht geb. 31.07.2004 - seit 25.09.2008 in Münster (aus Harderwijk) - am 05.02.2013 nach Harderwijk
Transferiert:
Kite (Großer Tümmler) - Im März 2012 in den Park Sauvage nach Frankreich transferiert - Planète Sauvage, Safari-Park in der Nähe von Nantes)
Paco (Sotalia-Delfin aus Mexiko) - verstorben am 30.12.2009 - Wildfang
Sämtliche Sotalia-Delfine aus Kuba, Kolumbien und Mexiko in deutschen Delfinarien verstorben
Traurige Bilanz deutscher Delfinarien
Stolz verwies man im Delfinarium in Münster auf das hohe Alter des verstorbenen Sotalia-Delfins Paco von etwa 40 Jahren (Wildfang aus Mexiko). Verschwiegen wurde aber, dass alle anderen Sotalia-Delfine in Deutschland frühzeitig verstorben sind:
Keines dieser Tiere erreichte ein hohes Alter:
COCO - aus Kolumbien - 04/2001
SABU - aus Kolumbien - 05.05.1992 - gestorben an Enteritis, Gastriitis
ROSITA - Kolumbien - 23.11.1978 - TuberKulose
INES - 01.02.1987 Leberdegeneration, bedingt durch Schwangerschaft u. Fehlgeburt
1. BABY von INES - 01.02.1987 - Totgeburt
JUAN - Kolumbien - 24.02.1966 - Hirnödem, Hautenzündung
EVITA - Kolumbien - 20.10.1993 - Papavorvirus, Hautkrebs
Eine nachhaltige Nachzucht gelang in keinem Delfinarium in Deutschland. Kein einziger überlender Meeressäuger wurde jemals wieder in die Natur zurückgebracht, obwohl dies lt. EU-Zoo-Richtlinie zu den Aufgaben der Zoos in Deutschland gehört. Die Delfine werden einzig und allein für kommerzielle Zwecke ausgebeutet.
Die meisten Freizeitparks und Zoos in Europa verzichten inzwischen auf die Haltung von Delfinen. Ein geplantes Delfinarium auf der Insel Rügen scheiterte an intensiven Protesten und Interventionen. In England wurden bereits alle der über 30 Einrichtungen geschlossen! In österreich gibt es keine Delfinarium mehr. In der Schweiz wurde im Frühjahr 2012 vom Parlament ein Delfinimportverbot beschlossen. Das letzt Delfinarium in der Schweiz (Connyland) schließt in 2013. Auch in South Carolina (USA) dürfen keine Delfine mehr gehalten werden und Australien verbietet den Bau neuer Delfinarien.
Im Mai 2007 wurde der Bau eines neuen Delfinariums mit geplanter Delfintherapie in Vodnjan (Kroatien) verboten. Dank umfangreicher internationaler Proteste konnte der Bürgermeister von Vodnjan in Kroatien davon überzeugt werden, dass Delfinarien Auslaufmodelle sind. 2009 beschloss Kroatien als erstes europäisches Land, den Import von Delfinen für Delfinarien zu verbieten.
In Deutschland ist man diesbezüglich weitaus rückständiger. Noch immer sind zukünftig nach der Schließung in Münster von ehemals neun Delfin-Anlagen immer noch zwei Delfinarien (Duisburg und Nürnberg) in Betrieb.
Es wird immer wieder die Frage gestellt, was mit den Delfinen passiert, wenn die Delfinarien geschlossen werden. In Deutschland liegt die Verwendung der Tiere in erster Linie in der Verantwortung der drei verbliebenen Zoo-Delfinarien in Duisburg, Münster und Nürnberg. Diese müssen ein entsprechendes Zookonzept in Abstimmung mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) vorlegen.
In der EG-Verordnung 338/97 sind die Kriterien des Handels mit Wildtieren zu deren Schutz festgelegt.
In der sog. EU-Zoorichtlinie (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:094:0024:0026:DE:PDF) heißt es bezogen auf die Zoos:
"Sie (Anm. die Zoos) beteiligen sich an Forschungsaktivitäten, die zur Erhaltung der Arten beitragen, und/oder an der Ausbildung in erhaltungsspezifischen Kenntnissen und Fertigkeiten und/oder am Austausch von Informationen über die Artenerhaltung und/oder gegebenenfalls an der Aufzucht in Gefangenschaft, der Bestandserneuerung oder der Wiedereinbürgerung von Arten in ihren natürlichen Lebensraum" (aus RICHTLINIE 1999/22/EG DES RATES vom 29. März 1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos).
Dementsprechend sind alleine die Zoos für eine "Wiedereinbürgerung in den natürlichen Lebensraum" verantwortlich. Das WDSF hat den Zoodirektoren der drei noch vorhandenen Delfinarien in Deutschland seine Unterstützung bei der Frage der Verwendung der Delfine angeboten. Wir haben mehrfach vorgeschlagen, die Meeressäuger aus den Betonbecken in teiloffene Meereslagunen unter menschlicher Obhut zu transferieren, um sie auf eine evtl. Auswilderung vorzubereiten. Nicht jeder Delfin lässt sich aufgrund seiner langjährigen Gefangenschaft wieder auswildern - für Nachzuchten scheidet eine vollständige Auswilderung weitgehend aus. Eine bedingungslose Auswilderung wäre der sichere Tod der Tiere. Trotz dieses Wissens werden in den Zoo-Delfinarien Nürnberg und Duisburg weiterhin verantwortungslos Nachzuchten produziert, obwohl die Population des Großen Tümmlers nicht vom Aussterben bedroht ist.
Durch die monotone Haltung in den kleinen Gehegen mit Swimmingpool-Größe haben die Delfine die eigene Nahrungsjagd verlernt. Das Sonar wird von den Tieren nur noch selten eingesetzt, weil der Rückschall von den engen Betonwänden Irritationen bei den Delfinen auslöst. Die Fütterung erfolgt durch die Tierpfleger gezielt in das Maul der Delfine.
Nachdem die Zoos mit ihren Delfinarien jahrzehntelang Millionen verdient haben, ist ihnen durchaus zuzumuten, die finanziellen Mittel für die Transfers zur Verfügung zu stellen und für eine lebenslängliche Betreuung der Meeressäuger in weitgehender Freiheit zu sorgen.
Seit Jahren setzen wir uns dafür ein, dass die Bundesregierung ein ausnahmsloses Importverbot für Delfine und Wale (Cetacea) beschließt, zumal die Bundesratsermächtung für solch einen Bundestagsbeschluss bereits in § 13 Tierschutzgesetz verankert ist - bis heute hat keine der Regierungskoalitionen dafür plädiert. In der Schweiz wurde nach intensiven WDSF-Protesten aufgrund mehrerer Delfin-Todesfälle im Connyland-Delfinarium (Kanton Thurgau) im Frühjahr 2012 ein bedingungsloses Importverbot beschlossen.